Du hast ein Haus oder eine Wohnung geerbt? Dann solltest du wissen, wie hoch die Erbschaftssteuer auf Immobilien ausfallen kann – und wie du sie berechnest. Unser Ratgeber zeigt dir Schritt für Schritt, worauf es ankommt. Mit Rechner.
Das Wichtigste in Kürze
- Für Kinder gilt ein Freibetrag von 400.000 Euro, für Ehepartner 500.000 Euro. Erst darüber wird Erbschaftssteuer fällig.
- Die Höhe der Steuer hängt vom Verwandtschaftsgrad und vom Verkehrswert der Immobilie ab.
- Sonderregeln gelten bei selbstgenutztem Wohneigentum – hier kann die Steuer entfallen.
- Der Verkehrswert wird vom Finanzamt geschätzt – ein Gutachten kann helfen, Steuern zu sparen.
- Erben müssen den Nachlass innerhalb von 3 Monaten anzeigen – und haben 6 Wochen Zeit, um das Erbe auszuschlagen.
- Nach dem Steuerbescheid bleibt 30 Tage Zeit für Widerspruch.
Erbschaftssteuer-Rechner 2025: Jetzt Erbschaftssteuer berechnen
Übersicht: Erbschaftssteuer
- Erbschaftssteuer bei Immobilien
- Wie hoch ist die Erbschaftssteuer für meine Immobilie?
- Wie berechne ich die Erbschaftssteuer für mein Haus?
- Finanzamt setzt Verkehrswert oft pauschal an
- Wann wird die Erbschaftssteuer fällig?
- Steuerberatung und Notarkosten: Was kommt auf Erben zu?
- Sonderfälle bei der Erbschaftssteuer
- Schenkung zu Lebzeiten: So sparen Kinder Steuern
- Worauf muss ich bei einer Schenkung achten?
- Fazit: Erbschaftssteuer sparen ist möglich
Erbschaftssteuer bei Immobilien
In Deutschland werden jedes Jahr rund 400 Milliarden Euro vererbt – ein großer Teil davon sind Immobilien. Wer ein Haus oder eine Wohnung erbt, muss dafür oft Erbschaftssteuer zahlen.
Für Kinder des Erblassers gilt ein Freibetrag von 400.000 Euro. Liegt der Wert der Immobilie darüber, wird Steuer fällig. Für entferntere Verwandte oder nicht verheiratete Partner gilt ein anderer Freibetrag und meist eine höhere Steuerlast.
Entscheidend ist, wie viel die Immobilie wert ist – und ob sie selbst genutzt wird. Wer die Regeln kennt, kann viel Geld sparen.
Realistischer Schätzwert für deine Immobilie
Wie hoch ist die Erbschaftssteuer für meine Immobilie?
Für die Höhe der Erbschaftssteuer gelten feste Freibeträge und Steuersätze – abhängig vom Verwandtschaftsgrad zum Erblasser. Kinder der Erblasser müssen Erbschaftssteuer erst dann zahlen, wenn der Wert der geerbten Immobilie den Freibetrag von 400.000 Euro übersteigt.
Bei Ehepartnern liegt der Freibetrag sogar bei 500.000 Euro. Erst wenn diese Summen überschritten werden, wird Erbschaftssteuer fällig.
Wie viel genau, hängt zusätzlich von der Steuerklasse ab. Dasselbe gilt auch für den Fall der Schenkung.
Info: Freibeträge und Steuerklassen sind im Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz (§ 16 ErbStG) geregelt.
| Erbe (Steuerklasse) | Freibetrag |
| Ehegatte/Lebenspartner (Steuerklasse I) | 500.000 Euro |
| Kinder (Steuerklasse I) | 400.000 Euro |
| Enkel (Steuerklasse I) | 200.000 Euro |
| Geschwister, Neffen, Nichten, Eltern, Großeltern, Stiefeltern, Schwiegereltern, Schwiegerkinder, geschiedene Ehegatten (Steuerklasse II) | 20.000 Euro |
| Alle übrigen Erben, auch nichtverheiratete Partner (Steuerklasse III) | 20.000 Euro |
Liegt der Wert des Erbes über dem Freibetrag, muss auf den überschüssigen Betrag eine Steuer gezahlt werden. Die Höhe der Steuer hängt von der Steuerklasse ab:
| Wert bis einschließlich | Steuersatz in der Steuerklasse | ||
| I | II | III | |
| 75.000 Euro | 7 % | 15 % | 30 % |
| 300.000 Euro | 11 % | 20 % | 30 % |
| 600.000 Euro | 15 % | 25 % | 30 % |
| 6.000.000 Euro | 19 % | 30 % | 30 % |
| 13.000.000 Euro | 23 % | 35 % | 50 % |
| 26.000.000 Euro | 27 % | 40 % | 50 % |
| über 26.000.000 Euro | 30 % | 43 % | 50 % |
Info: Wer eine Immobilie im Ausland besitzt, sollte sich frühzeitig über die dortigen Steuergesetze informieren. Wichtig ist auch, ob es ein Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland gibt. Das kann die Steuerlast deutlich beeinflussen. Besteht kein Abkommen, kann es passieren, dass der Erbe auf das Vermögen in beiden Ländern Erbschaftssteuer zahlen muss.
- Wer seine Immobilie nach seinem Tod in vertrauensvolle Hände übergeben möchte, muss bedenken, dass oft eine Erbschaftssteuer anfällt. Hier liest du was du noch beachten musst, wenn du ein Haus erbst.
Wie berechne ich die Erbschaftssteuer für mein Haus?

Wer seine Immobilie nach seinem Tod in vertrauensvolle Hände übergeben möchte, muss bedenken, dass oft eine Erbschaftssteuer anfällt. Foto: Sunny studio / stock.adobe.com
Bei der Berechnung der Erbschaftssteuer für ein Haus kommt es auf folgende Faktoren an:
- Der Immobilienwert
- Hiervon wird der Freibetrag abgezogen, abhängig vom Verwandtschaftsverhältnis
- Der den Freibetrag überschießende Teil wird mit dem aus der Tabelle ersichtlichen Steuersatz versteuert.
Beispiel: Erbt die Tochter das Haus im Wert von 500.000 Euro, muss sie – da sie einen Freibetrag von 400.000 Euro hat – 100.000 Euro versteuern.
Kinder haben die Steuerklasse I – entsprechend wird der Betrag mit 11 Prozent Erbschaftssteuer belegt. Dies entspricht 11.000 Euro.
Erbschaftssteuer Schritt für Schritt berechnen: So gehst du vor
Du möchtest wissen, wie hoch die Erbschaftssteuer für dein geerbtes Haus oder deine Wohnung ausfällt? Mit den folgenden Schritten kannst du das selbst berechnen. Oder du nutzt direkt den Erbschaftssteuer-Rechner auf dieser Seite.
1. Verkehrswert der Immobilie ermitteln
Die Grundlage für jede Berechnung ist der Verkehrswert der Immobilie. Das ist der Betrag, den das Haus oder die Wohnung zum Tode des Erblassers gerade wert ist. Ermittelst du ihn nicht selber, schätzt den Wert das zuständige Finanzamt.
Wenn du Zweifel an der Höhe hast, kann ein unabhängiges Gutachten helfen. Mehr dazu erfährst du im Artikel Verkehrswert Immobilie.
Tipp: Steuern sparen: Mit einem Gutachten für eine kürzere Restnutzungsdauer kann der Verkehrswert geschmälert werden, was zu deutlich weniger Erbschaftssteuer führen kann.
2. Freibetrag abziehen
Abhängig vom Verwandtschaftsgrad zwischen Erben und Erblasser steht dir ein steuerfreier Betrag zu. Für Kinder sind es 400.000 Euro, für Ehepartner 500.000 Euro.
Die Freibeträge für weitere Familienverhältnisse entnimmst du der Tabelle am Anfang des Artikels. Nur der darüber liegende Teil des Erbes wird besteuert.
3. Steuerklasse bestimmen
Deine Steuerklasse richtet sich ebenfalls nach dem Verwandtschaftsgrad:
- Steuerklasse I: Ehepartner, Kinder, Enkel
- Steuerklasse II: Geschwister, Nichten, Neffen, Schwiegereltern
- Steuerklasse III: Alle übrigen Personen (auch nicht verheiratete Lebenspartner)
4. Steuersatz anwenden
Nun schaust du in die Steuertabelle (§ 19 ErbStG). Welcher Steuersatz trifft auf deinen steuerpflichtigen Restbetrag zu?
Für Kinder gelten z. B. bei einem zu versteuernden Anteil von 100.000 Euro 11 % Erbschaftssteuer. Die ganze Liste haben wir für dich oben angehängt.
5. Steuer berechnen
Zum Schluss multiplizierst du den zu versteuernden Betrag mit dem passenden Steuersatz.
Beispiel: Du erbst ein Haus im Wert von 500.000 €. Als Tochter hast du 400.000 € Freibetrag → 100.000 € sind steuerpflichtig. Bei 11 % Steuersatz musst du 11.000 € Erbschaftssteuer zahlen.
Der Erbschaftssteuer-Rechner auf dieser Seite übernimmt alle Schritte für dich – inklusive Sonderregelungen wie Pflegefreibetrag oder Steuerstundung. Einfach Verkehrswert, Verwandtschaftsverhältnis und Nutzung eintragen – und du erhältst dein Ergebnis sofort.
Verkehrswert für höhe der Erbschaftsteuer wichtig
Doch bevor mit der Rechnung zur Erbschaftssteuer startest, musst du wissen, wie viel die Immobilie wert ist. Und zwar zum Zeitpunkt des Erbfalls. Maßgeblich ist hier der sogenannte Verkehrswert der Immobilie. Er beschreibt den geschätzten Preis, den ein Objekt unter normalen Marktbedingungen erzielen würde.
Wie wird der Verkehrswert der Immobilie ermittelt?
Für die Ermittlung des Verkehrswerts kommen je nach Art und Nutzung der Immobilie unterschiedliche Bewertungsverfahren zum Einsatz:
- Beim Vergleichswertverfahren wird der Immobilienwert anhand kürzlich verkaufter, vergleichbarer Objekte in ähnlicher Lage geschätzt.
- Das Ertragswertverfahren richtet sich nach den erwarteten Mieteinnahmen.
- Das Sachwertverfahren berücksichtigt die Herstellungskosten des Gebäudes sowie den Bodenwert.
Finanzamt setzt Verkehrswert oft pauschal an
Gut zu wissen: Das Finanzamt setzt den Verkehrswert in vielen Fällen pauschal an. Der fällt oft fällt dieser zu hoch aus. Wer das Gefühl hat, dass der Wert nicht dem tatsächlichen Marktwert entspricht, kann ein unabhängiges Verkehrswertgutachten erstellen lassen.
Damit lässt sich unter Umständen erfolgreich Widerspruch gegen den Steuerwert einlegen, um die Steuerlast zu senken. Wie genau sich dieser Wert bestimmen lässt, erklären wir ausführlich in unserem Ratgeber zum Verkehrswert einer Immobilie.
Verkürzte Restnutzungsdauer kann bei Erbschaft Steuern sparen
Um den Verkehrswert einer Immobilie zu ermitteln, ist die Kenntnis der Nutzungsdauer, insbesondere der Restnutzungsdauer, entscheidend. Die Restnutzungsdauer gibt an, wie lange eine Immobilie wirtschaftlich genutzt werden kann, und wird bei der Bewertung des Verkehrswertes berücksichtigt.
Ein Gutachter kann die Restnutzungsdauer und den Verkehrswert basierend auf verschiedenen Faktoren, wie dem Baujahr, dem Zustand der Immobilie und durchgeführten Modernisierungen, ermitteln. Erfahre alles zum Thema im Artikel zur Restnutzungsdauer zusammengefasst.
Wann wird die Erbschaftssteuer fällig?
Sobald ein Erbe vom Nachlass erfährt, hat er drei Monate Zeit, dies dem Finanzamt zu melden. Erst danach prüft das zuständige Finanzamt den Fall und fest, ob und in welcher Höhe Erbschaftssteuer fällig wird. Diese Anzeigepflicht ist in § 30 des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes (ErbStG) geregelt.
Kann der Erbe die Erbschaftssteuer in Raten zahlen?
Ein Immobilien-Erbe kostet. Erben können die Steuer oft nicht sofort begleichen. Vor allem, wenn kein weiteres Vermögen vorhanden ist.
In solchen Fällen besteht die Möglichkeit, beim Finanzamt eine Stundung der Steuer zu beantragen. Wird diese bewilligt, kann die Steuer über einen längeren Zeitraum hinweg in Raten gezahlt werden.
Die maximale Stundungsdauer beträgt bis zu 10 Jahre. Meistens Zinslos. Vor allem dann, wenn so ein drohender Hausverkauf vermieden werden kann.
Was passiert, wenn der Erbe die Erbschaftssteuer nicht zahlen kann?
Ein Stundungsantrag hat nur dann Aussicht auf Erfolg, wenn der Erbe keine anderen finanziellen Mittel hat. Also weder Barvermögen noch die Möglichkeit, die Immobilie zu beleihen oder einen Kredit aufzunehmen.
Das Finanzamt prüft streng und erwartet oft, dass Erben zur Zahlung auch Schulden in Kauf nehmen. Wichtig: Sobald der Steuerbescheid vorliegt, bleibt nur ein Monat Zeit zur Zahlung.
Wer mehr Zeit braucht, sollte frühzeitig eine Fristverlängerung oder Stundung beantragen. So können zusätzliche Kosten oder Maßnahmen zur Vollstreckung vermieden werden.
Widerspruch gegen den Steuerbescheid: 30-Tage-Frist
Nach der Abgabe der Erbschaftsteueranzeige prüft das Finanzamt den Fall und erlässt bei Bedarf einen Feststellungsbescheid oder direkt einen Erbschaftsteuerbescheid. Stellt der Erbe dabei einen zu hohen Immobilienwert oder falsche Annahmen fest, sollte er aktiv werden: Ein Widerspruch ist binnen 30 Tagen nach Zustellung möglich.
In der Praxis lohnt sich ein Widerspruch oft dann, wenn der angesetzte Verkehrswert deutlich über dem tatsächlichen Marktwert liegt. Ein unabhängiges Gutachten kann hier als Beleg dienen – und im besten Fall zu einer Senkung der Erbschaftssteuer führen. Die Frist ist strikt: Wer sie versäumt, akzeptiert den Steuerbescheid mit allen Konsequenzen.
Wann wird keine Erbschaftssteuer fällig?
In einigen Ausnahmefällen fällt gar keine Erbschaftssteuer an. Zum Beispiel, wenn eine Ehefrau nach dem Tod ihres Ehegatten das gemeinsame Zuhause erbt – ganz oder teilweise. Voraussetzung: Der Verstorbene hat dort gewohnt, und die Immobilie wird mindestens 10 Jahre lang weiter genutzt.
In diesem Fall profitiert die Ehefrau unabhängig vom Verkehrswert der Immobilie von einer Steuerbefreiung. Die Ausnahme gilt auch, wenn der überlebende Ehepartner nicht mehr in der Immobilie wohnen kann. Zum Beispiel, weil er ins Pflegeheim zieht.
Übersteigt die Wohnfläche der Immobilie 200 Quadratmeter nicht, können auch die Kinder des Erblassers von dieser Steuerbefreiung profitieren. Diese Regelung gilt aber ausschließlich im Erbfall, nicht bei einer Schenkung.
Steuerberatung und Notarkosten: Was kommt auf Erben zu?
Wer eine Immobilie erbt, hat nicht nur Fragen zur Erbschaftssteuer, sondern auch zu zusätzlichen Kosten. Etwa für einen Steuerberater oder Notar. Diese Ausgaben können sich lohnen, sollten aber vorab gut eingeschätzt werden.
Was kostet ein Steuerberater bei der Erbschaftssteuer?
Die Kosten der Steuerberatung hängen meist vom Wert der Erbschaft ab. Grundlage ist die Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV). Sie regelt die Gebühren nach einem festgelegten Faktor. Je nach Aufwand wird ein Regelsatz zwischen 0,2 und 1,0 multipliziert
Beispiel:
Bei einem Erbe von 500.000 Euro beträgt die volle Gebühr laut Tabelle der StBVV rund 3.051 Euro. Der Steuerberater kann nun einen Teilbetrag zwischen 610 Euro (0,2-fach) und 3.051 Euro (1,0-fach) verlangen. In der Praxis liegt der Betrag häufig bei rund 2.000 Euro – je nach Komplexität des Falls.
Tipp:
Lass dir vorab ein konkretes Angebot machen und kläre, ob Pauschalen oder Stundenhonorare möglich sind. Gerade bei einfacheren Erbfällen ist der Beratungsaufwand oft geringer, als die Verordnung suggeriert.
Was kostet ein Notar bei Schenkung oder Erbregelung?
Auch Notare spielen bei der Erbschafts- oder Schenkungsplanung eine wichtige Rolle. Etwa bei der Erstellung eines Testaments oder bei der Übertragung eines Hauses zu Lebzeiten. Die Kosten richten sich nach dem Gerichts- und Notarkostengesetz (GNotKG) und bemessen sich am Wert des Vermögens.
Beispiel:
Für die Beurkundung der Übertragung einer Immobilie im Wert von 500.000 Euro fällt eine Gebühr von rund 2.257 Euro an.
Kommt noch die Eintragung ins Grundbuch hinzu, kommen etwa 935 Euro hinzu. Insgesamt ist mit Kosten von ca. 3.200 Euro zu rechnen.
Kann man diese Kosten steuerlich absetzen?
Ja – zumindest im Rahmen der Erbschaftssteuerberechnung. Die Kosten für die Steuerberatung, die direkt mit dem Erbe zusammenhängen, gelten als Nachlassverbindlichkeiten (§ 10 Abs. 5 ErbStG).
Sie mindern den steuerpflichtigen Erbwert. Das heißt: Sie senken die Erbschaftssteuer. In der normalen Einkommensteuererklärung lassen sie sich jedoch nicht absetzen.
Auch Notarkosten, etwa für Testamentseröffnung oder Erbscheinanträge, gelten als abzugsfähige Nachlasskosten. Wichtig ist, dass die Leistung im Zusammenhang mit der Abwicklung des Erbes steht – nicht mit späteren Vermögensfragen.
Weitere Tipps zur Beratersuche
Eine qualifizierte Begleitung durch einen Steuerberater oder Fachanwalt für Erbrecht kann bei komplexen Erbfällen viel Geld sparen.
Sonderfälle bei der Erbschaftssteuer
Erbschaftssteuer bei Mietimmobilien
Hinterlässt der Erblasser eine vermietete Immobilie, kommen auch die Ehepartner und die Kinder nicht um eine Steuerzahlung herum. Diese errechnet sich aus dem Verkehrswert der Immobilie. Allerdings nimmt das Finanzamt einen Bewertungsabschlag von 10 Prozent des Verkehrswertes vor.
Erbschaftssteeur für Stiefkinder
Stiefkinder haben in der Regel keinen Anspruch auf einen Pflichtteil. Denn rechtlich gesehen sind Stiefkinder und Stiefeltern nicht verwandt, sondern nur verschwägert. Entsprechend sind sie die gesetzlichen Erben ihres leiblichen Elternteils.
Letztlich können Stiefkinder nur dann erben, wenn sie im Testament oder im Erbvertrag bedacht werden. Bei der Erbschafts- und Schenkungssteuer gibt es allerdings keine Unterschiede zwischen den leiblichen und Stiefkindern.
Schenkung zu Lebzeiten: So sparen Kinder Steuern
Die Schenkung ist ein Tipp zur steuerfreien Immobilie für Kinder. Sie haben bei Schenkung wie bei der Erbschaft jeweils einen Freibetrag von 400.000 Euro. Und das alle 10 Jahre pro Elternteil.
So können bei Schenkungen Immobilien sogar steuerfrei übertragen werden, wenn Teile über einen längeren Zeitraum verschenkt werden.
Beispiel: Frau Huber hat eine oder mehrere Immobilien im Wert von 800.000 Euro. Sie schenkt ihrem Sohn eine oder einen Teil ihrer Wohnung im Wert von 400.000 Euro. Steuerfrei.
Zehn Jahre später folgt die zweite oder der restliche Teil der Wohnung bis zu 400.000 Euro – wieder steuerfrei.
Hat sich weiteres Vermögen angehäuft? Oder ist der Wert der Immobilie gestiegen? Dann kann der Überschuss erneut nach 10 weiteren Jahre steuerfrei verschenkt werden
Stirbt Frau Huber vorher, zählt die letzte Schenkung noch als Erbe. Aber nur der Rest muss noch versteuert werden.
Worauf muss ich bei einer Schenkung achten?
Die Schenkung erfolgt im Gegensatz zum Erbe noch zu Lebzeiten. Schenkende wie Beschenkte sollten dabei auf einiges achten:
Rückforderung der Schenkung
Eine Schenkung kann nur in besonderen Fällen rückgängig gemacht werden. Das ist möglich, wenn der Schenker in Geldnot kommt (§ 528 BGB) oder der Beschenkte sich grob undankbar verhält (§ 530 BGB). Grober Undank ist beispielsweise bei körperlichen Misshandlungen, Bedrohungen oder schweren Beleidigungen gegeben.
Eine Schenkung kann auch zurückverlangt werden, wenn sich die Gründe dafür später als falsch herausstellen.
Anrechnung des Pflichtteils
Schenkungen der Eltern an ein Kind werden unter bestimmten Voraussetzungen nicht auf den Pflichtteil eines anderen Kindes angerechnet. Hat der Verstorbene kurz vor seinem Tod etwas verschenkt, kann es trotzdem einen Anspruch auf Pflichtteilsergänzung geben.
Das regelt § 2325 BGB. In diesem Fall darf der Pflichtteilsberechtigte verlangen, dass die Schenkung wie ein Teil des Erbes behandelt wird. Er bekommt entsprechend mehr.
Ausgleich bei mehreren Kindern
Eltern können einem Kind schon zu Lebzeiten etwas schenken. Die anderen Kinder bekommen dann erst später im Erbfall ihren Anteil. Wird dabei eine Immobilie verschenkt, sollten sich die Eltern zur Sicherheit ein Wohnrecht oder Nießbrauchrecht im Vertrag sichern. So können sie das Haus weiter selbst nutzen oder es vermieten – auch nach der Schenkung.
Fazit: Erbschaftssteuer sparen ist möglich
Wer früh plant, kann seinen Kindern hohe Erbschaftssteuern ersparen – zum Beispiel durch Schenkungen zu Lebzeiten. Oft ist die Beratung durch einen Notar sinnvoll. Ein Erbvertrag oder Testament kann spätere Streitereien unter den Begünstigten vermeiden helfen.


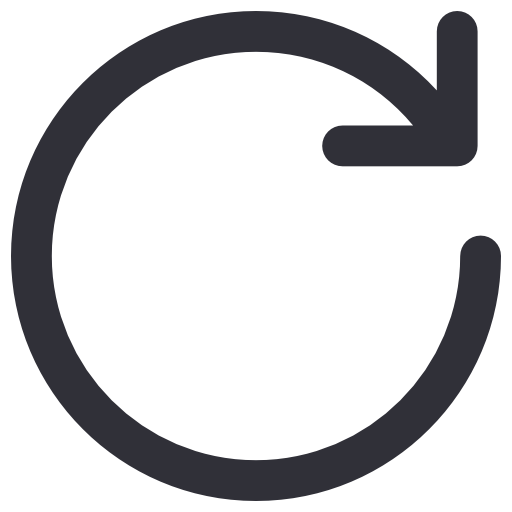 Aktualisiert am 06.08.2025
von
Aktualisiert am 06.08.2025
von 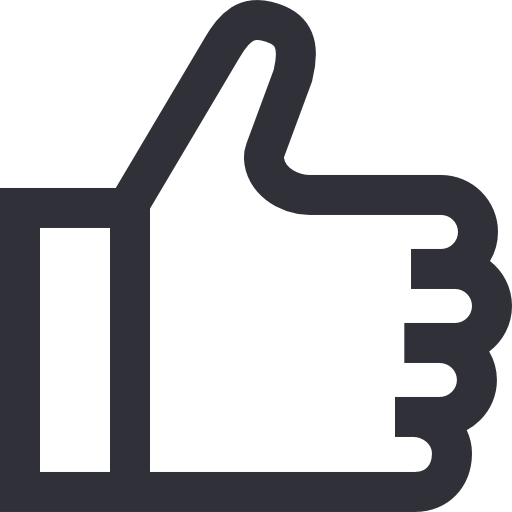 100% der Leser fanden diesen Artikel hilfreich
100% der Leser fanden diesen Artikel hilfreich






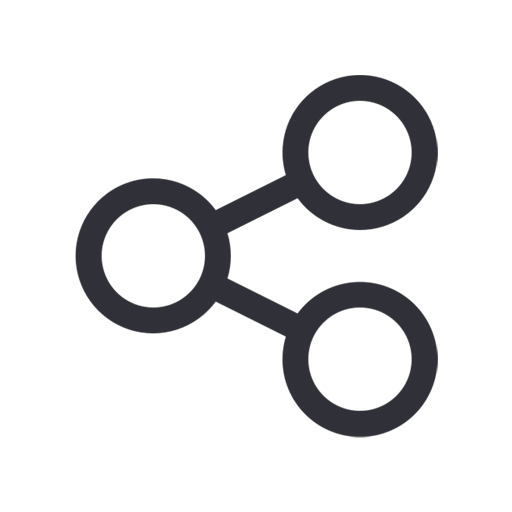 Seite weiterleiten
Seite weiterleiten
 Artikel drucken
Artikel drucken


